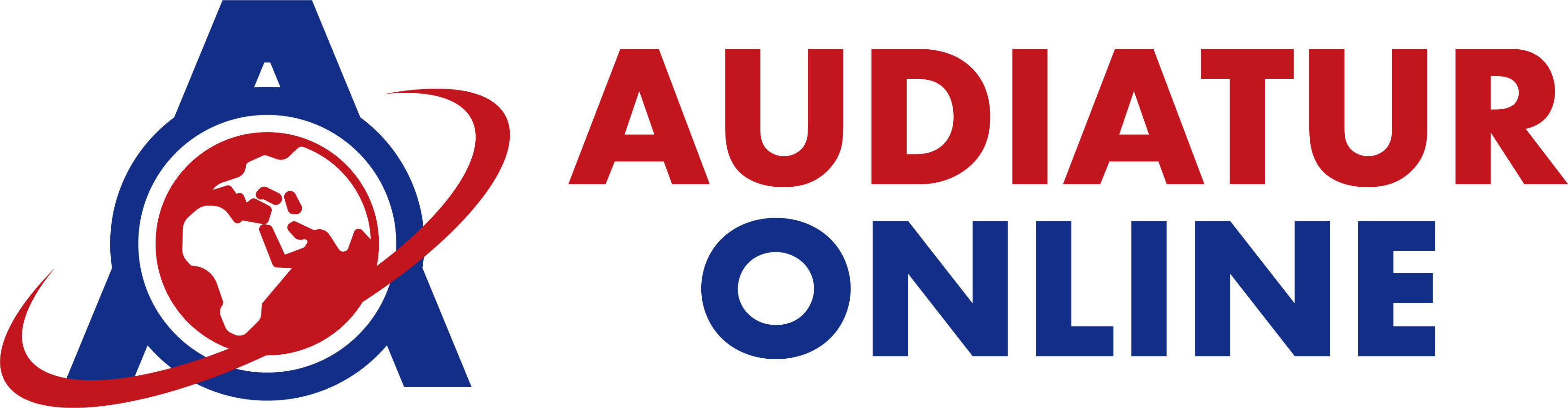Am frühen Morgen des 7. Oktober 2023 wurde Israel von einem barbarischen Angriff erschüttert, dessen Brutalität bis heute kaum fassbar ist. Terroristen der Hamas und mehr als tausend aus Gaza stammende Zivilisten überrannten die Grenze zu Südisrael. Sie ermordeten, folterten, vergewaltigten, verbrannten Menschen bei lebendigem Leib und filmten ihre Gräueltaten, als wären sie Trophäen. Während Israel über 1000 Tote beklagte, formierten sich nur einen Tag später weltweit Solidaritätskundgebungen – jedoch nicht mit den Opfern, sondern mit den Tätern. Der moralische Zusammenbruch in Teilen des Westens entfaltete sich öffentlich und in Echtzeit.
Der Dokumentarfilm «Pogrom(s)» des französisch-israelischen Regisseurs Pierre Rehov setzt genau hier an. Er geht dahin, wo Worte kaum noch ausreichen und Bilder eigentlich unerträglich werden. Die 90-minütige Produktion des Middle East Studio aus dem Jahr 2024 gibt jenen eine Stimme, die als Erste die Tatorte betraten: Rettungskräfte, Soldaten, Ermittler, Menschen, deren Leben von jenen Szenen gezeichnet bleibt, die sie dort vorfanden. Sie berichten von Zimmern voller Leichen, von ausgebrannten Häusern, von verstümmelten Körpern, von Kindern, für deren Identifikation nicht einmal mehr Familienangehörige ausreichten. Ihre Zeugnisse bilden das Herz des Films und machen aus dem 7. Oktober das, was er war: das grösste antisemitisch motivierte Massaker nach der Shoah.
Die deutsche Fassung des Films wurde von Visual Productions produziert, gemeinsam mit Hanspeter Büchi, Liliane Bernet-Bachmann und Marc Villiger. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Dokumentation einem deutschsprachigen Publikum zugänglich zu machen, damit die Realität dieses Tages nicht durch politisierte Narrative überdeckt oder relativiert wird.
Regisseur Pierre Rehov weiss genau, wovon er spricht. Er wurde in Algier in eine jüdische Familie geboren, zu einer Zeit, als Algerien noch ein französisches Departement war. Der Terrorismus prägte seine Kindheit, denn seine eigene Schule wurde Ziel eines Anschlags der algerischen Nationalen Befreiungsfront FLN. 1961 musste seine Familie wie viele andere «Pieds-Noirs» (in Algerien lebende Franzosen) fliehen, weil nach der algerischen Unabhängigkeit Vergeltungsangriffe gegen nichtmuslimische Bewohner befürchtet wurden. Diese persönlichen Erfahrungen machen Rehov zu einem ungewöhnlich klaren Beobachter von Gewalt, Ideologie und Identitätszerstörung. Seine späteren Dokumentarfilme befassen sich seit Jahren mit dem arabisch-israelischen Konflikt, der dschihadistischen Ideologie und dem Missbrauch der Medien durch terroristische Organisationen.
«Pogrom(s)» beleuchtet nicht nur das unmittelbare Verbrechen, sondern auch die Ideologien, die zu ihm führten. Rehov zeigt anhand historischer Analysen und zeitgenössischer Befunde, wie sich der Hass der Hamas nicht im luftleeren Raum entwickelte. Der Film verfolgt die ideologischen Linien zurück zu den Verbindungen zwischen nationalsozialistischen Netzwerken und islamistischen Bewegungen in den 1940er-Jahren. Er macht deutlich, wie die Muslimbruderschaft über Jahrzehnte hinweg ihre Narrative in muslimische Gesellschaften einpflanzte und wie die Hamas diese Ideologie in den 1990er-Jahren zu einer totalitären und blutigen Vision ausformte. Rehov verweist auf die in Gaza gefundenen Exemplare von «Mein Kampf» und zeigt, dass die antisemitische Motivation der Terroristen nicht zufällig war, sondern tief in dieser jahrzehntelang kultivierten Vernichtungsfantasie wurzelt.
Der Film führt den Zuschauer damit zu einer Frage, die auch in Israel selbst in den Tagen nach dem 7. Oktober schmerzhaft offenbar wurde: Wie konnte sich die westliche Öffentlichkeit so schnell von den Fakten lösen? Wie konnte die moralische Dringlichkeit dieses Massakers innerhalb weniger Stunden hinter politischen Parolen verschwinden? Und wie konnten Akademiker, Aktivisten und Teile der Medienlandschaft noch am selben Wochenende beginnen, die Täter als «Widerstandskämpfer» zu verklären und die Opfer unsichtbar zu machen?
Rehov liefert keine theologischen oder soziologischen Spekulationen, sondern zeigt, was an diesem Tag geschah und welche ideologischen Traditionen diesem Ereignis vorausgingen. Der Film verweigert sich der Relativierung und konfrontiert damit ein globales Publikum, das sich allzu oft an moralische Ausweichmanöver gewöhnt hat.
«Pogrom(s)» ist deshalb weit mehr als eine Dokumentation. Er ist ein Gegenentwurf zur internationalen Verzerrung, die seit dem 8. Oktober 2023 zu beobachten ist. Er ist ein notwendiges Zeugnis in einer Zeit, in der das Erinnern an die Ermordeten angegriffen wird – nicht durch Schweigen, sondern durch aktive Verdrehung.
Wer verstehen will, was am 7. Oktober wirklich geschah und warum dieser Tag eine historische Zäsur darstellt, kommt an diesem Film nicht vorbei. Er macht die Opfer sichtbar, er bringt ihre Stimmen zurück in den öffentlichen Raum – und er widerspricht dem Versuch, die Wahrheit zu verwässern. «Pogrom(s)» ist ein filmisches Dokument gegen das Vergessen und gegen die Verharmlosung des Judenhasses, der an diesem Tag seine grausamste Fratze zeigte.
Hinweis zur Verfügbarkeit und Altersbeschränkung
Die Dokumentation «Pogrom(s)» ist online in zwei Versionen zugänglich. Auf YouTube ist der Film unter der Adresse youtube.com/watch?v=DZyMzl-2NXw verfügbar, allerdings nur mit Altersbeschränkung. Viele Zuschauer werden erst nach einer Verifizierung Zugriff erhalten, was den unmittelbaren Zugang erschwert. Eine frei zugängliche Version ohne Altersbeschränkung steht hingegen auf Vimeo bereit unter vimeo.com/1110063074.
Die Produzenten weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Film trotz sorgfältiger Redaktion belastendes Material enthält. Empfindsame Menschen könnten durch manche Bilder in der Dokumentation verstört werden. Aus Dutzenden von Stunden Filmmaterial wurden die am wenigsten grausamen ausgewählt. Es ist jedoch schwierig, Zeuge eines Massakers zu sein, ohne ein Minimum an visuellen Belegen zu zeigen.
Dieser Hinweis der Produzenten ist nicht nur eine formale Vorsichtsmassnahme, sondern ein notwendiger Schutz für Zuschauer, die sich der Realität des 7. Oktober annähern möchten, ohne auf die harte visuelle Wahrheit vorbereitet zu sein.