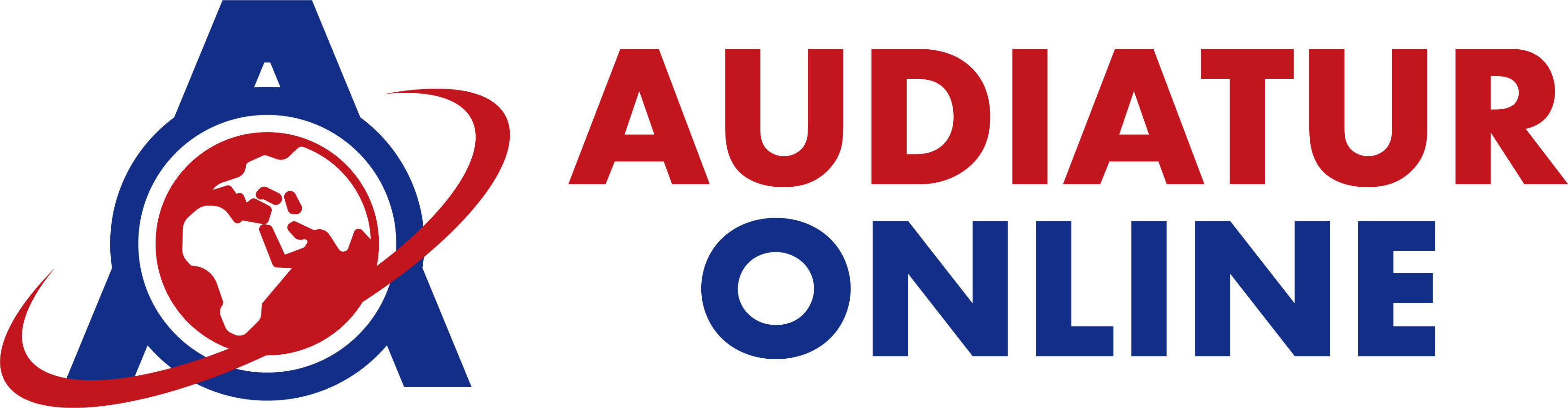Die Behauptung, Al-Aqsa stehe vor der Zerstörung, gehört seit Jahrzehnten zu den wirkungsvollsten politischen Mythen des Nahostkonflikts. Sie hat Gewalt legitimiert, historische Fakten verzerrt und das Klima rund um den Tempelberg dauerhaft vergiftet – trotz fehlender Grundlage.
Die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem ist mehr als ein Gebäude; sie ist ein emotionales Nervenzentrum für einen grossen Teil der muslimischen Welt. Als Ort, der mit der Nachtreise des Propheten Mohammed und der frühen Gebetsrichtung des Islam verbunden wird, gilt sie als drittheiligstes Heiligtum des Islam. Für die Palästinenser ist der Al-Aqsa-Komplex – mit der silbernen Kuppel der Qibli-Moschee und der goldenen Kuppel des Felsendoms – zu einem nationalen Emblem geworden, das auf Plakaten und Fahnen erscheint, in Reden wie bei Beerdigungen beschworen wird. Für nationalistische Bewegungen wie Fatah und Islamisten wie Hamas oder den Islamischen Dschihad ist die Moschee zudem eine mobilisierende Marke: ein fertiges Banner, unter dem Gewalt als religiöse Pflicht inszeniert wird und sogenannten „Widerstand“ – in Wirklichkeit Terrorismus – zur „Verteidigung des Islam“ umetikettiert werden kann.
Die Sensibilität wächst, weil Al-Aqsa auf einem Plateau steht, das für eine andere Glaubensgemeinschaft ebenso heilig ist. Der Moscheekomplex thront auf dem Tempelberg – hebräisch Har HaBayit, arabisch al-Haram asch-Scharif („das Edle Heiligtum“) –, jenem Ort, an dem einst zwei jüdische Tempel standen: der Erste Tempel, der König Salomo zugeschrieben und im 6. Jahrhundert v. Chr. von den Babyloniern zerstört wird, und der Zweite Tempel, nach dem babylonischen Exil wiederaufgebaut, später unter Herodes dem Grossen erweitert und 70 n. Chr. von Rom zerstört. Für Juden ist dieser Ort der heiligste Punkt der Erde, die Achse des Gebets und der Platz, an dem die göttliche Gegenwart nach ihrem Glauben für immer wohnt. So entsteht ein einziger Platz, der zwei sich überlagernde, nicht verhandelbare Erzählungen in sich trägt – islamisches Heiligtum oben, jüdische Heiligkeit darunter – und damit wohl der umstrittenste heilige Ort der Welt und ein permanenter Brennpunkt des israelisch-palästinensischen Konflikts ist.
Der Islam legte seine eigene Geschichte über denselben Stein. Spätere Überlieferungen berichten, Mohammed sei von hier aus in der Nacht der Himmelsreise (al-Isra wa-l-Miʿrāǧ) in den Himmel aufgestiegen. Der Koran bleibt hier jedoch auffallend vage. Er spricht von einer nächtlichen Reise von der „heiligen Moschee“ in Mekka zur „fernsten Moschee“ (al-Masdschid al-Aqsa), nennt aber weder Jerusalem noch dessen späteren arabischen Namen al-Quds und beschreibt weder einen bestimmten Felsen noch ein Gebäude; einige frühe Traditionen verorteten diese „fernste Moschee“ sogar im Himmel.
Die al-Aqsa-Moschee ist auch als „Qibli-Moschee“ bekannt – die Moschee, die in Richtung der Qibla, also der Gebetsrichtung, steht. Frühe islamische Überlieferung berichtet, dass Mohammed nach seinem Umzug nach Medina seine Anhänger zunächst anwies, in Richtung Jerusalem zu beten – zu einem Zeitpunkt, als es dort noch gar keine Moschee gab. Damit präsentierte er sich als Erbe der biblischen Propheten und suchte jüdische Verbündete gegen Mekka. Als die meisten jüdischen Stämme seinen Anspruch zurückwiesen und sich das Verhältnis bis hin zu Belagerung, Vertreibung und – im Fall von Banū Qurayza – Massaker verschlechterte, wurde die Qibla dauerhaft nach Mekka verlegt.
Erst nach Mohammeds Tod und der arabischen Eroberung Jerusalems – im 7. Jahrhundert dem Byzantinischen Reich unter Kalif Umar ibn al-Chattab abgerungen – wurde der Tempelberg als al-Masdschid al-Aqsa beansprucht, sodann als drittheiligster Ort des Islam nach Mekka und Medina. Unter christlicher Herrschaft war das frühere Tempelareal weitgehend eine Ruinenlandschaft geblieben, stellenweise als Müllkippe genutzt – eine „Theologie aus Stein“, die signalisieren sollte, dass der jüdische Tempel endgültig gerichtet und ersetzt sei.
Auf diesen Trümmern errichteten die Umajjaden ihre eigenen Monumente: 691/692 liess Kalif ʿAbd al-Malik den goldenen Felsendom über dem Grundstein bauen, wenige Jahrzehnte später vollendete sein Sohn al-Walid I. die heute silbern bekuppelte Al-Aqsa-Moschee – eine architektonische Machterklärung darüber, wer den Hügel beherrschte.
In diese Spannung wurde vor mehr als einem Jahrhundert eine einfache, mächtige und tödliche Lüge hineingetragen – verdichtet in den Slogan „Al-Aqsa ist in Gefahr“ – und sie ist nie wirklich verschwunden. Seit den frühen 1920er Jahren behaupten arabische Führer und Geistliche immer wieder, Zionisten oder Israel schmiedeten Pläne, Al-Aqsa zu zerstören und an ihrer Stelle einen wiederaufgebauten jüdischen Tempel zu errichten. Hadsch Amin al-Husseini, der Grossmufti von Jerusalem, nutzte diesen Vorwurf, um die Unruhen von 1929 anzuheizen, darunter das Massaker von Hebron, das eine jüdische Gemeinde auslöschte, die dort seit Jahrhunderten gelebt hatte.
Jahrzehnte später erklärte Jassir Arafat, die jüdischen Tempel hätten überhaupt nicht auf dem Berg gestanden, sondern etwa im Jemen. Im Jahr 2000 etikettierten palästinensische Führer die Zweite Intifada als „Al-Aqsa-Intifada“ und nutzten Ariel Scharons Besuch auf dem Tempelberg als bequemen Vorwand für eine von langer Hand vorbereitete Terrorkampagne.
Seit Israel 1967 die Altstadt von Jordanien erobert hat, wird nahezu jede sichtbare jüdische Präsenz auf dem Berg – insbesondere Besuche hochrangiger Politiker – als Versuch denunziert, die Moschee zu „stürmen“ und den „Status quo zu verändern“. Dieser Status quo ist ein fragiles Arrangement: Die jordanisch gestützte islamische Waqf-Behörde verwaltet die Stätte und ausschliesslich Muslime dürfen dort beten, während Israel die Oberhoheit über Sicherheit und Zugang behält. Juden und andere Nichtmuslime dürfen den Ort nur zu begrenzten Zeiten als Touristen besuchen und sind formell von öffentlichem Gebet ausgeschlossen. Von al-Husseinis Agitation bis zu Hamas’ „Al-Aqsa-Flut“ im Jahr 2023 – dem Namen, den die Organisation dem Massaker vom 7. Oktober gab und als Mission zur „Rettung“ von Al-Aqsa verkaufte – zieht sich eine durchgehende Linie. Ist diese Prämisse erst einmal akzeptiert, wird jedes Bauprojekt, jede Auseinandersetzung mit der Polizei und jede Tat eines extremistischen Randakteurs zu einem weiteren „Beweis“ für einen bevorstehenden Abriss.
Im Folgenden fünf wiederkehrende Varianten, wie Israel angeblich plant, Al-Aqsa zu zerstören.
1. Das „zionistische“ Erdbeben
Am äussersten Ende des Spektrums steht der Vorwurf vom „künstlichen Erdbeben“.
Ende 2000, auf dem Höhepunkt der Zweiten Intifada, schickte der palästinensische Geheimdienstoffizier Oberst Mahmoud Abu Samra ein Memorandum an Jassir Arafat, in dem er behauptete, Israel habe ein geheimes Komitee aus führenden Wissenschaftlern des Technion, des Weizmann-Instituts und der nuklearen Anlage im Negev zusammengestellt, um Al-Aqsa „ohne Fingerabdruck“ zu zerstören. Das Komitee, schrieb er, habe bereits 1999 unter dem Wasser des Toten Meeres und in der Negev-Wüste Experimente durchgeführt. Ihr angeblicher Werkzeugkasten hätte eher in einen Katastrophenfilm als in einen Geheimdienstbericht gepasst: ein ausgelöstes Erdbeben unter der Moschee, kollidierende Schallwellen, die die Mauern nach innen drücken, die Erzeugung eines Luftvakuums und künstlicher Gewitterstürme!
Arafat nahm das ernsthaft und bereitwillig auf. Das Dokument, das während der israelischen Anti-Terror-Operation „Defensive Shield“ 2002 von israelischen Kräften im Jerusalemer Orient-Haus der PLO gefunden wurde, trug seine handschriftliche Anweisung, es unter führenden ostjerusalemer Funktionären zu verbreiten. Mit anderen Worten: Die Führung sollte diese absurde Phantasie als reale Bedrohung behandeln. Belege dafür, dass ein solches Komitee je existiert hätte, geschweige denn über Wetterkontroll- oder Erdbebentechnologie verfügte, sind nie aufgetaucht.
2010 berichtete die saudische staatliche Nachrichtenagentur, der Präsident der Arabischen Geologenvereinigung habe vor einem israelischen „künstlichen Erdbeben“ gewarnt, das dazu führen könne, dass die „gesegnete Al-Aqsa-Moschee“ in sich zusammenstürzt – eine politische Verschwörungstheorie, als „wissenschaftlich“ verpackt.
Fast ein Jahrzehnt später, 2018, nach einer Reihe leichter Erdbeben im Norden Israels, behauptete Kamal Zakarneh, Kolumnist der jordanischen Tageszeitung Al-Dustour, diese könnten durch unterirdische Tests nuklearer oder anderer Waffen entstanden sein, die Israel entwickle. Der ehemalige Jerusalemer Mufti Ikrima Sabri warnte ebenfalls, Israel könne ein „künstliches Erdbeben“ auslösen, um die Moschee zum Einsturz zu bringen, und sogar der griechisch-orthodoxe Erzbischof Atallah Hanna schloss sich an und sprach von menschengemachten Beben, die auch andere heilige Stätten Jerusalems bedrohten, darunter die Grabeskirche.
Die Ironie: Die Moschee ist tatsächlich mehrfach durch reale Erdbeben schwer beschädigt oder zerstört worden – in den Jahren 746, 1033, 1837 und 1927. Die eigentliche zerstörerische Kraft war der instabile Boden unter Jerusalem, nicht eine geheime zionistische Erdbebenmaschine.
2. Tunnel und Ausgrabungen: Der Abrissplan
Wenn die Erdbebenmaschine die spektakulärste Lüge ist, dann ist die Geschichte von Tunneln und Ausgrabungen die zäheste – und am weitesten verbreitete. Seit 1967 graben israelische Archäologen entlang der Westmauer und am südlichen Rand des Tempelbergs und legen Überreste aus der Zeit des Zweiten Tempels, der Römer, der Byzantiner und des frühen Islam frei – ausserhalb des ummauerten Plateaus. In grossen Teilen der arabischen Presse werden diese Arbeiten kaum je als archäologische Ausgrabungen beschrieben. Fast immer ist von „Tunneln unter Al-Aqsa“ und „Ausgrabungen unter der Moschee“ die Rede, dargestellt als heimliches Projekt, die Fundamente auszuhöhlen und die Moschee zum Einsturz zu bringen.
Das Muster zeigte sich bereits 1996, als Israel einen zweiten Ausgang des sogenannten Westmauertunnels eröffnete. Der Gang verläuft entlang der Mauer, nicht unter der Moschee selbst. Palästinensische Führer beschrieben ihn jedoch umgehend als „grossen antiken Tunnel unter al-Haram asch-Scharif“. Der damalige Grossmufti von Jerusalem, Ekrima Saʿid Sabri, soll Jassir Arafat angerufen und ihn gewarnt haben, „die Juden graben unter dem Tempelberg“. In den anschliessenden Auseinandersetzungen wurden Dutzende Palästinenser und mehr als ein Dutzend israelische Soldaten und Polizisten getötet. Eine technische Entscheidung, die den Andrang in einem Besuchertunnel verringern und die Sicherheit erhöhen sollte, wurde in einen weiteren „Beweis“ für ein Komplott zur Unterminierung von Al-Aqsa verwandelt.
Eine Variante desselben Vorwurfs begleitete die Kontroverse um die Rampe des Mughrabi-Tores zwischen 2004 und 2007. Nachdem ein Sturm und ein leichtes Erdbeben die Erdrampe beschädigt hatten, über die Nichtmuslime und israelische Polizisten den Berg betraten, errichtete Israel eine provisorische Holzbrücke und begann im Vorhof an der Westmauer mit Ausgrabungen für einen dauerhaften Ersatz. Hamas, Saudi-Arabien und andere Akteure beschuldigten Israel lautstark, an den Fundamenten Al-Aqsas zu graben, um die „islamischen Merkmale der Moschee zu zerstören“ und ihre Stabilität zu gefährden. Als UNESCO-Experten die Stätte inspizierten, stellten sie fest, dass die Arbeiten auf einen Bereich einige Meter von der Mauer entfernt beschränkt waren, mit leichten Werkzeugen durchgeführt wurden und keine strukturelle Gefahr für die Moscheen darstellten. In der Verschwörungserzählung fanden ihre Schlussfolgerungen jedoch kaum Widerhall.
Dennoch verabschiedete dieselbe UNO-Organisation rund ein Jahrzehnt später eine palästinensisch entworfene Jerusalem-Resolution, die den Tempelberg nur als „Al-Aqsa-Moschee / al-Haram asch-Scharif“ bezeichnete und über das „ständige Eindringen“ israelischer „Extremisten“ und „Aggressionen“ durch „die Besatzungsmacht“ klagte – ein sprachlicher Kunstgriff, der die jüdische Verbindung faktisch auslöschte und zeigte, wie tief das Narrativ „Al-Aqsa ist in Gefahr“ in die Sprache internationaler Institutionen eingedrungen war.
Ein ähnliches Drehbuch wurde mit neuen Details im Juli 2017 wiederholt. Nachdem drei arabisch-israelische Terroristen vom Tempelberg herabgekommen und zwei israelische Drusenpolizisten ermordet hatten, griffen die israelischen Behörden zu einem ungewöhnlichen Schritt und schlossen das Gelände für zwei Tage, um nach Waffen und Beweismitteln zu suchen. Als es wieder geöffnet wurde – mit neuen Metalldetektoren an einigen Toren -, löste dies Empörung bei palästinensischen Führern und auf der radikalisierten Strasse aus. Adnan al-Husseini, damals Minister der Palästinensischen Autonomiebehörde für Jerusalemer Angelegenheiten, beschuldigte Israel, die Schliessung genutzt zu haben, um „über die Treppen in die Zisternen hinabzusteigen“ und „die Grabungen“ unter Al-Aqsa fortzusetzen, als Vorbereitung auf einen Dritten Tempel. In den sozialen Medien kursierten Beiträge mindestens eines der Attentäter, der gewarnt hatte, „Al-Aqsa ist in Gefahr“, als nachträgliche Rechtfertigung.
Mitte der 2020er Jahre war das Motiv „Ausgrabungen = Abrissplan“ zu einem ständigen Refrain geworden: Palästinensische Funktionäre und regionale Medien sprachen von „64 aktiven Grabungen und Tunneln“ rund um den Komplex, die angeblich die Fundamente Al-Aqsas gefährdeten. In Wirklichkeit hat keine unabhängige Untersuchung ein „abrissbereites Tunnelnetz“ gefunden. Die einzigen erwiesenen Tunnel-Experten der Region sitzen im Gazastreifen, wo Hamas seit Jahren Hunderte Kilometer von Terrortunneln in den Boden fräst – um nach Israel einzudringen, Raketen und Kämpfer zu bewegen und entführte Israelis zu verstecken.
3. Der chemische Korrosionsplan
Wo Erdbeben und Tunnel scheitern, tritt die Chemie auf den Plan.
2017 erklärte Scheich Kamal Khatib, langjähriger stellvertretender Vorsitzender des nördlichen Zweigs der Islamischen Bewegung in Israel – einer Organisation, die 2015 von der israelischen Regierung wegen Aufstachelung und Verbindungen zur Hamas verboten wurde – gegenüber Al-Dschasira, Israel injiziere seit 22 Jahren heimlich „chemische Substanzen“ in Mauern und Fundamente der Al-Aqsa-Moschee. Ziel sei es, so behauptete er, sicherzustellen, dass die Moschee eines Tages von selbst einstürze, sodass Israel den Einsturz auf „natürliche Ursachen“ schieben könne.
Der absurde Vorwurf, den weder ingenieurtechnische Gutachten noch Proben oder Videoaufnahmen stützten, blieb vom arabischen Al-Dschasira-Moderator im Kern unwidersprochen. Er behandelte ihn als glaubwürdig, statt nach Beweisen zu fragen. Von dort aus wanderte die Behauptung in regionale Medien und sogar in einige wissenschaftliche Texte über religiöse Radikalisierung und wurde Teil des breiteren Ökosystems von Al-Aqsa-Verschwörungserzählungen – in dem die Vorstellung, Israel lasse heimlich die Fundamente der Moschee korrodieren, all jenen plausibel erscheinen kann, die ohnehin überzeugt sind, es sei auf ihre Auslöschung aus.
4. Die Brandstiftung, die zum Staatsverbrechen wurde
Nicht alle Al-Aqsa-Geschichten sind völlig frei erfunden. Einige beginnen mit einem realen Verbrechen und entfernen dann sorgfältig den Täter.
Am 21. August 1969 setzte ein 28-jähriger Australier namens Denis Michael Rohan die kunstvoll gestaltete Kanzel aus dem 12. Jahrhundert in der südlichen Gebetshalle der Al-Aqsa-Moschee in Brand. Er war kein Israeli, kein Jude und kein Mossad-Agent. Er war ein Christ mit apokalyptischen Überzeugungen, der den Ermittlern sagte, Gott habe ihn beauftragt, den Ort zu räumen, damit der Tempel wieder aufgebaut werden könne und Christus zurückkehre. Die israelische Polizei nahm ihn innerhalb von zwei Tagen fest. Ein Gericht erklärte ihn für schuldunfähig; er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und fünf Jahre später nach Australien abgeschoben.
In vielen arabischen Nacherzählungen wurde die Geschichte von Anfang an umgeschrieben. Schon als sich das Feuer ausbreitete, riefen Betende „die Juden, die unser Heiligtum angezündet haben“, die weitere muslimische Welt machte Israel rasch für die Brandstiftung verantwortlich, und Saudi-Arabiens König Faisal ordnete sogar an, die Streitkräfte für einen Heiligen Krieg bereitzumachen. Denis Michael Rohan wird zum „zionistischen Siedler“, zum „jüdischen Terroristen“, zum Undercover-Agenten – oder aber ganz aus der Geschichte entfernt – und die Brandstiftung als Angriff „der Besatzung“ erinnert, als Beleg dafür, dass Israel schon einmal versucht habe, die Moschee niederzubrennen.
Jahr für Jahr wird der Jahrestag von Medien in der gesamten Region von Iran bis Mauretanien aufgegriffen. 2017 wiederholte ein Berater von Präsident Mahmoud Abbas diese Behauptung und erklärte, die Moschee „brenne noch heute“ unter israelischer Herrschaft. Am 21. August 2021 bezeichnete Abbas anlässlich des 52. Jahrestags des Anschlags Rohan fälschlich als „jüdischen Extremisten“ und machte „die Juden“ für die Brandstiftung verantwortlich. In Jordanien zitierte die offizielle Nachrichtenagentur – die Jordan News Agency (Petra) – den vom König ernannten Generalsekretär des Königlichen Jerusalem-Komitees, der den Anschlag fälschlich einem „israelischen Extremisten Michael [sic] Rohan“ zuschrieb und erklärte, das Hauptziel der zionistischen Bewegung sei die Zerstörung Al-Aqsas. Im August 2025 ging ein Beitrag der „Global Campaign to Return to Palestine“ noch weiter, stellte den Brand als Beginn eines „organisierten Projekts“ der „Judaisierung“ der Moschee dar und schloss mit der Feststellung, Al-Aqsa bleibe „Symbol des Widerstands und eines Identitätskampfes, der noch lange nicht entschieden ist“.
5. Bomben, KI und Randphantasien
Eine weitere Variante des Narrativs „Al-Aqsa ist in Gefahr“ ist zugleich die visuellste: Israel werde die Moschee mit Bomben zerstören. Diese Idee kursiert seit Langem in Zeitungskarikaturen – israelische Kampfjets, Lenkraketen, der Felsendom in Flammen -, doch im April 2025 wanderte sie in ein neues Medium. Ein von Künstlicher Intelligenz erzeugtes Video mit dem Titel „Nächstes Jahr in Jerusalem“ tauchte auf hebräischsprachigen Randkanälen auf und zeigte, wie Al-Aqsa bombardiert und durch einen strahlenden Dritten Tempel ersetzt wird. Das palästinensische Aussenministerium griff den Clip auf, bezeichnete ihn als „systematische Provokation mit dem Ziel, Angriffe auf islamische und christliche heilige Stätten im besetzten Jerusalem zu eskalieren“ und als Beleg für eine „Aufwiegelung rechtsextremer Siedler, Al-Aqsa in die Luft zu sprengen“. In derselben Erklärung warf es der israelischen Führung „Judaisierungs- und koloniale Pläne“ sowie „andauernde genozidale Verbrechen“ vor und forderte die Vereinten Nationen und internationale Gerichte auf, das Video als Grundlage für rechtliche Schritte gegen Israel zu nutzen.
An diesem Punkt mischt sich ein Körnchen unangenehme Tatsache mit einer grossen Dosis Propaganda. Einerseits hat der israelische Staat wiederholt erklärt, dass er den Status quo nicht verändern will; andererseits hat eine winzige Randgruppe jüdischer Extremisten tatsächlich von der Zerstörung der islamischen Heiligtümer fantasiert: 1984 schmiedeten Mitglieder der „Jüdischen Untergrundbewegung“ einen Plan, den Felsendom in die Luft zu sprengen; sie wurden von Israel verhaftet und inhaftiert. 2009 gab Jaakov Teitel – heute in Israel wegen anderer Terroranschläge in Haft – zu, er habe zeitweilig erwogen, eine selbstgebaute Mörsergranate auf die Moschee abzufeuern, den Plan aber verworfen, weil er fürchtete, dabei Juden zu töten.
Diese Episoden sind wichtig, werden aber routinemässig aus ihrem Kontext gerissen, der Tatsache beraubt, dass Israel selbst sie verhindert hat, und in eine einzige Botschaft gegossen: Israel plane, Al-Aqsa zu bombardieren. Genau diese Lücke zwischen Randphantasie und Staatspolitik löscht die „Al-Aqsa-ist-in-Gefahr“-Verleumdung aus. In ihrem Narrativ wird ein KI-Video einer Handvoll Radikaler oder ein vereitelter Anschlag von vor Jahrzehnten zum „Beweis“ für die angeblichen Absichten Israels insgesamt – und zur stets verfügbaren Rechtfertigung für alles, von Steinwürfen bis hin zu Massenterroranschlägen, die als vorbeugende „Verteidigung“ der Moschee inszeniert werden.
Die „Al-Aqsa-ist-in-Gefahr“ – Verleumdung verwandelt Ingenieurarbeit in Sabotage, Archäologie in Abriss, einzelne geistig gestörte Täter in Staatsagenten und Randphantasten in die Stimme Israels. Sie hält die palästinensische Gesellschaft in einem dauerhaften Belagerungsgefühl gefangen, macht Kompromisse über Jerusalem unmöglich und verwandelt jede Eskalation in einen Heiligen Krieg. Ehrlich darüber zu sprechen bedeutet nicht, die muslimische Verbundenheit mit Al-Aqsa zu leugnen; es bedeutet, darauf zu bestehen, dass heilige Stätten durch Fakten, Recht und Zurückhaltung geschützt werden – nicht durch Propaganda und Blutverleumdungen.