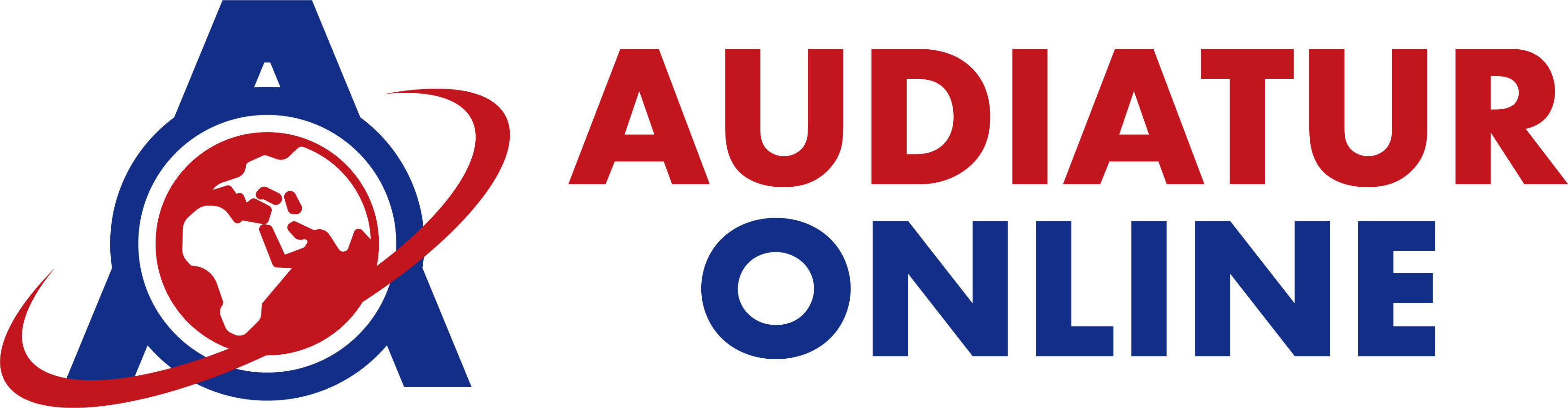Wir alle wissen, dass Jom Kippur etwas Besonderes ist. Die historische, traditionelle Melodie von Kol Nidrei vermittelt jedem ein feierliches, heiliges Gefühl. Auch wenn wir es nicht genau erklären können, ist es doch so, in jeder Synagoge auf der ganzen Welt.
von Rabbi Yossy Goldman
Und dann gibt es noch die kurze Einleitung, die wir unmittelbar vor Kol Nidrei rezitieren: „Mit der Zustimmung des Allmächtigen und mit der Zustimmung der Gemeinde, mit der Autorität des himmlischen Gerichts und mit der Autorität des irdischen Gerichts erteilen wir hiermit die Erlaubnis, mit denen zu beten, die gesündigt haben.“
Einige erklären, dass dies auf die dunklen Tage der spanischen Inquisition zurückgeht, als es Juden unter Androhung der Todesstrafe verboten war, ihr Judentum auszuüben. Viele Marranos, also heimlich praktizierende Juden, verkündeten öffentlich, dass sie sich zum vorherrschenden Glauben bekehrt hätten, während sie insgeheim weiterhin ihren eigenen jüdischen Glauben praktizierten. Tatsächlich wurden viele von ihnen gefasst und auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Manche glauben auch, dass Kol Nidrei zu dieser Zeit seine besondere Kraft erhielt. Denn diese Juden widerriefen die Gelübde, Eide und Versprechen, die sie gegen ihren eigenen Glauben abgelegt hatten, und kehrten nun zurück, um dem einzigen Gott Israels zu dienen.
Und so sprechen wir ein besonderes Gebet, um diese Juden, die offen christlich und heimlich jüdisch waren, wieder in die Gemeinde aufzunehmen. Diese „Übertreter“ wurden von der Gemeinde willkommen geheissen.
Es ist, als würden wir gleich zu Beginn von Jom Kippur, noch vor Kol Nidrei, öffentlich verkünden: Alle sind sich einig, dass es an diesem Tag keine Unterschiede zwischen Juden gibt; wir stehen alle vereint, gemeinsam als Einheit, in der Gegenwart Gottes.
Auch heute ist ein wichtiges Thema von Jom Kippur die Einheit der Juden.
Eine Synagoge ist eine „heilige Versammlung“. Manchmal verstehen die Menschen nicht, warum Versammlungen nicht genauer darauf achten, wen sie als Mitglieder zulassen. Warum sollte jemand, der wegen Unterschlagung verurteilt wurde oder dessen Untreue gegenüber seinem Ehepartner bekannt ist, in eine Gemeinschaft aufgenommen werden, die behauptet, nach Heiligkeit zu streben?
Ob Sie es glauben oder nicht, manche behaupten, dass Menschen, die sich nicht strikt an die Kaschrut-Gesetze halten oder die sich nicht strikt an die Schabbat-Gesetze halten, keinen Platz im Gotteshaus haben sollten. Und für viele Menschen lautet die grosse Frage: Warum sollten solche Menschen in der Synagoge geehrt werden? Und sogar zur Tora gerufen werden.
Die Antwort findet sich in der bescheidenen Erklärung, dass es erlaubt, ja sogar erwartet ist, dass wir gemeinsam beten, selbst mit „Übertretern“.
Ich kenne den Autor nicht, aber jemand hat einmal Folgendes gesagt: „Perfektion ist keine Voraussetzung, um einer heiligen Gemeinschaft beizutreten. Wir sind alle unvollkommen, und die Synagoge ist daher bestenfalls eine Ansammlung von Menschen, die sich noch weiterentwickeln müssen. Was die Gläubigen verbindet, ist nicht das, was sie erreicht haben, sondern das, was sie zu erreichen versuchen. Wir kommen am Jom Kippur zusammen, um anzuerkennen, dass wir besser sein wollen, dass wir besser sein müssen und dass wir verstehen, dass wir, wenn wir die Unvollkommenheiten anderer akzeptieren, hoffen können, dass sie im Gegenzug unsere eigenen Unvollkommenheiten akzeptieren und vergeben.“
Aber die Grundprämisse lautet: „Ein Jude ist ein Jude, ist ein Jude, ist ein Jude.“ Ad infinitum!
Ich könnte so viele Geschichten erzählen, die dieses Thema widerspiegeln. Ich bin mir sicher, dass jeder von Ihnen das auch könnte.
Hier nur ein Beispiel: Der Vater eines Freundes von mir rannte einmal in eine brennende Synagoge, um die Sifrei Torahs aus der Heiligen Lade zu retten. Die Feuerwehrleute warnten ihn davor, aber er rannte trotzdem hinein. Nun war dieser Mann keineswegs ein religiöser Mensch, aber für ihn stand die Rettung der Thora-Rollen ausser Frage. Es musste einfach getan werden. Er brachte sein eigenes Leben in echte Gefahr, um unsere kostbaren, heiligsten religiösen Gegenstände zu retten. Ist das nicht „religiös“?
Wir dürfen niemals selbstgefällig werden. Wir müssen alle weiter wachsen, aber niemand darf das Gefühl haben, dass er nicht zu Gott und unserem Glauben beiträgt, egal was passiert.
Das ist eine Botschaft, die jeder religiöse Jude hören muss. Denn allzu oft werden viele noch nicht religiöse Juden durch intolerante und wertende Menschen vom Glauben abgehalten.
Haben Sie die israelische Fernsehserie „Shtisel“ gesehen? Ich nicht. Aber ich habe von vielen Leuten viel darüber gehört. Hat Sie der religiöse Vater manchmal irritiert? Er war sehr frum, nicht wahr? Dennoch bekam ich den Eindruck, dass er vielleicht nicht so tolerant, fair oder vernünftig war.
Oder was ist mit denen, die in Jerusalem am Sabbat Steine auf jeden werfen, den sie beim Autofahren an diesem heiligen Tag erwischen? Wissen Sie, es gab einmal eine Demonstration gegen dieses Verhalten. Und auf einem der Plakate, die die Demonstranten hochhielten, stand: „Befreit Jerusalem aus der Steinzeit!“
Würden Sie diese Art von Juden als „religiös“ bezeichnen? Sind sie gute Beispiele dafür, wie religiöse Juden handeln oder sich verhalten sollten? Sind sie loyale Botschafter unseres Glaubens?
Glauben Sie mir, ich bin nicht hier, um jemanden zu kritisieren, sondern nur, um uns zum Nachdenken anzuregen, innehalten und überlegen zu lassen: Wissen wir wirklich, wer „religiös“ und wer ein „Übertreter“ ist?
Der Lubawitscher Rebbe – Rabbi Menachem Mendel Schneerson – lehrte, dass wir nicht wissen, wer „religiös“ ist, und dass wir Menschen nicht beurteilen sollten, weder rechts noch links noch irgendwo dazwischen.
Ich schliesse mit dieser Geschichte, die zeigt, dass Menschen, die wir normalerweise nicht mit „Religiosität“ in Verbindung bringen, dennoch ein starkes jüdisches Bewusstsein haben und dass wir dies als die wahre innere Identität und Realität jedes einzelnen Juden anerkennen sollten, unabhängig davon, ob dies oberflächlich betrachtet offensichtlich ist oder nicht.
Ein Mann in Jerusalem sprach das Trauergebet Kaddisch für seine Mutter. Wie Sie wissen, sprechen wir das Kaddisch elf Monate lang nach dem Tod eines Elternteils, aber man kann es nur sprechen, wenn man mit einem Minyan betet, einer Gruppe von zehn jüdischen Erwachsenen, die das Bar-Mizwa-Alter erreicht haben.
Jeden Tag sprach der Mann das Kaddisch für seine Mutter. Er versäumte keinen einzigen Gottesdienst. Dann, eines Nachts, kam er spät von einer Veranstaltung nach Hause. Es war ein Uhr morgens. Er fiel erschöpft ins Bett. Kaum hatte er das Licht ausgeschaltet, setzte er sich mit einem Ruck auf, als ihm klar wurde, dass er vergessen hatte, zum Abendgebet in die Synagoge zu gehen.
Mit grosser Anstrengung schleppte er sich aus dem Bett und begann sich anzuziehen, aber wo sollte er um diese Uhrzeit ein Minjan finden?
Kein Problem. Wie jeder, der in Jerusalem lebt, bestätigen kann, findet man Tag und Nacht immer ein Minjan im Shtiblach, einem Gebäude mit vielen kleinen Synagogenräumen im Stadtteil Zichron Moshe. Die Menschen versammeln sich in einem der Räume, und sobald zehn Männer anwesend sind, beginnen sie zu beten. Es ist wie eine Minjan-Fabrik dort. Man kann zu fast jeder Tageszeit vorbeikommen und findet einen Gottesdienst, der gerade beginnt.
Aber nicht um 1 Uhr morgens. Also holte der Mann sein Handy heraus und wählte die Nummer eines Taxiunternehmens. „Hallo! Können Sie bitte neun Taxis zum Shtiblach in Zichron Moshe schicken?“
„Adoni (‚Herr‘), es ist 1 Uhr morgens! Glauben Sie etwa, ich hätte neun Taxis? Was glauben Sie, was ich bin, ein Zauberer? … Ich habe nur fünf.“
„OK, dann schicken Sie fünf.“
Er wählte die Nummer einer anderen Taxizentrale. „Hallo, bitte schicken Sie fünf Taxis nach Zichron Moshe …“
„Atah meshugah? Sind Sie verrückt? Ich habe nur vier.“
„Okay, dann schicken Sie vier.“
Innerhalb von 20 Minuten stand eine Reihe von neun Taxis ordentlich vor dem Shtiblach. „Adoni“, sagte einer der Fahrer, „wozu brauchen Sie neun Taxis? Hier findet keine Hochzeit statt, keine Bar Mitzwa, nichts.“
„Hört mir zu, Chevra. Ich möchte, dass ihr alle eure Zähler einschaltet und mit mir hereinkommt. Wir werden gemeinsam das Abendgebet, Ma’ariv, beten. Ich werde jedem von euch bezahlen, als ob ihr mich mitnehmt.“
Diese Taxifahrer waren keine gläubigen Juden. Einige von ihnen hatten seit ihrer Bar Mitzwa keine Synagoge mehr betreten. Einige hatten eine Kippa in ihrem Handschuhfach, die sie seit Jahren nicht mehr benutzt hatten; dennoch staubten sie sie ab und setzten sie sich auf den Kopf, als sie die Synagoge betraten. Andere trugen Baseballmützen.
Obwohl sie fliessend Hebräisch sprachen, hatten diese Taxifahrer kaum eine Vorstellung davon, wie man betet, was man sagt, wann man Amen antwortet, wann man laut spricht und wann man still bleibt. Es dauerte eine Weile, aber der Mann, der das Kaddisch sprechen musste, zeigte ihnen, was zu tun war. In dieser Nacht in Jerusalem, um 1:30 Uhr morgens, konnte der Mann endlich das Kaddisch für seine Mutter sprechen.
Nach dem Gottesdienst gingen sie zurück zu den Taxis. Die Taxameter zeigten jeweils über 90 Schekel an. Der Mann holte seine Brieftasche heraus und begann, die etwa 800 Schekel abzuzählen, die ihn das kosten würde. Das sind fast 300 Dollar!
„Wie viel schulde ich Ihnen?“, fragte er den ersten Taxifahrer in der Reihe.
„Adoni, für wen halten Sie mich denn? Glauben Sie wirklich, ich würde Geld von Ihnen nehmen? Sie haben mir gerade die Gelegenheit gegeben, meinem jüdischen Mitmenschen zu helfen, das Kaddisch zu sprechen, und ich sollte Ihnen dafür Geld berechnen?“
Der Mann ging zum zweiten Fahrer, der ebenfalls die Bezahlung ablehnte und sagte: „Weisst du, wie lange ich schon nicht mehr gebetet habe?“
Und so ging es immer weiter. Kein einziger Taxifahrer war bereit, auch nur einen Schekel anzunehmen. Meine Freunde, kennt ihr israelische Taxifahrer? Sie gehören zu den eigensinnigsten Menschen in ganz Israel. Sie sind nicht schüchtern. Plötzlich wurden diese weltlichen Taxifahrer zu Zaddikim, zu heiligen Männern.
Das bestätigt nur meinen Standpunkt: Selbst Sünder sind heilig.
Lasst uns also keine voreiligen Urteile fällen. Ein Jude ist ein Jude ist ein Jude, und daran glauben wir mit jeder Faser unseres Wesens.
Mögen wir alle immer gemeinsam in die Synagoge kommen. Mögen wir alle gemeinsam beten. Mögen wir alle gemeinsam unseren Glauben praktizieren. Und mögen wir alle gemeinsam mit einem guten und glücklichen neuen Jahr gesegnet sein, während wir alle vereint als Einheit stehen. Amen!
Rabbi Yossy Goldman ist emeritierter Rabbiner der Sydenham Shul in Johannesburg und Präsident der South African Rabbinical Association. Er ist der Autor des Buches «From Where I Stand» über die wöchentlichen Tora-Lesungen, erhältlich bei Ktav.com und Amazon. Auf Englisch zuerst erschienen bei Jewish News Syndicate. Übersetzung und Redaktion Audiatur-Online.