Was wäre, wenn die Schweiz selbst das europäische Palästina würde – komplett mit NGOs, Hilfswerken und Resolutionen am Genfersee? Ein satirisches Gedankenexperiment über Europas moralische Bequemlichkeit, die Neutralität zur Ausrede macht und Verantwortung exportiert, solange jemand anders den Preis zahlt. Zwischen Alpenidylle und UNO-Bürokratie zeigt sich, wie leicht sich Moral verordnen lässt, wenn man sie nicht leben muss.
von Dan Deutsch
*Bern, 10. Oktober 2025* – In Reaktion auf anhaltende europäische Forderungen, Palästina endlich anzuerkennen, hat der Bundesrat beschlossen, mit gutem Beispiel voranzugehen.
Die Schweizerische Eidgenossenschaft stellt ihr Territorium hiermit grosszügig als Standort des neuen «Europäischen Staates Palästina» zur Verfügung. Vom Genfersee bis zum Bodensee sollen die Alpen künftig Dschabal al-Adl – die Berge der Gerechtigkeit – heissen. Das weisse Kreuz wird in das Muster eines Kufiya-Tuchs überführt – als Symbol einer neu entdeckten europäischen Tugend: der moralischen Auslagerung.
Eine gemischte Kommission klärt derweil, ob die Schweiz ihre Neutralität auch dann bewahren kann, wenn sie sich vollständig selbst ersetzt hat. Der Bundesrat dankt der internationalen Gemeinschaft für ihre Begeisterung und bittet die Nachbarländer, sich auf einen Zustrom von Beifall vorzubereiten.
Applaus. Verwirrung. Realität.
Die Schweiz, sonst berühmt für Stabilität, würde sich selbst exportieren. Die Banken schliessen für eine Woche zwecks «solidarischer Restrukturierung». Zürich benennt seine Tramlinien nach Friedensaktivisten, Genfer Uhrmacher bringen die Sonderedition «Time for Justice» heraus. Moralisches Kapital wird zur neuen Währung – bis Investoren merken, dass es keinen Zins abwirft.
Und was passiert mit den Institutionen, die bisher in der Schweiz sitzen? Genf bleibt Genf. Die internationalen Organisationen, die in der Stadt der Diplomatie und der roten Fahnen residieren – UN-Agenturen, Hilfswerke, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz – werden nicht in die Alpen «verlagert». Im satirischen Szenario dürfen sie selbstverständlich an Ort und Stelle verbleiben: schliesslich müssen diejenigen, die das Narrativ einer palästinensischen Selbstbestimmung so vehement propagieren, auch selbst mit dessen Konsequenzen leben. Sie würden zu direkten Zeuginnen und Verwalterinnen ihres eigenen Moralanspruchs – mit dem Vorteil, dass künftig jede Unstimmigkeit, jeder fragwürdige Lehrplan und jede problematische Personalentscheidung nicht mehr bequem dem fernen «Besetzten Gebiet» angelastet werden kann. Wenn die eigene Argumentation so eindeutig ist, müsste man sie auch vor der eigenen Haustür verteidigen können.
Natürlich ist das alles beissende Ironie. Doch die Pointe bleibt: Wer «Anerkennung» als gesichtslose Moralparole ruft, muss anschliessend auch erklären, wen genau er damit meint – und was er bereit ist, dafür zu tun.
Genf – die Hauptstadt der Moralindustrie
Die gleichen Regierungen, die Israel für sein Selbstverteidigungsrecht tadeln, pflegen florierende Handelsbeziehungen mit Regimen, die Völkerrecht systematisch verletzen. Laut Eurostat lag der EU-Handel mit dem Iran 2024 bei über 4 Milliarden Euro, während Katar als Energielieferant und Geldgeber islamistischer Bewegungen zugleich hofiert wird. Israel – eine Demokratie, die sich gegen genau diese Einflüsse wehrt – dient derweil als Projektionsfläche für europäische Schuldkomplexe.
Und mitten in dieser Szenerie steht Genf – Hauptstadt der internationalen Moralwirtschaft. Hier tagen Kommissionen, veröffentlichen Unterausschüsse Resolutionen und besprechen Panels die Konflikte anderer Kontinente bei Fair-Trade-Kaffee und Blick auf den See. In unserem satirischen Szenario bleibt Genf selbstverständlich unangetastet. Schliesslich sitzen hier die moralischen Institutionen, die sich seit Jahrzehnten für die «palästinensische Sache» einsetzen: Hilfswerke, Agenturen, Komitees, Kommissionen. Sie dürfen im neuen «europäischen Palästina» weiterarbeiten – diesmal allerdings an sich selbst.
Die UN-Büros hätten endlich Gelegenheit, ihre Lieblingsaufgabe im Eigenversuch zu perfektionieren: die Selbstregulierung ohne Ergebnis. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz könnte seine Neutralität direkt vor der eigenen Haustür erproben. Und die diversen «Zentren für Menschenrechte» hätten endlich ein ideales Beobachtungsfeld – sich selbst.
So würde Genf zur Hauptstadt der Selbstspiegelung: eine Stadt, die für jedes Problem ein Panel, für jede Tragödie ein Papier und für jede Verantwortung eine Subvention findet. Neutralität als Geschäftsmodell – das passt perfekt in die neue Ordnung.
Von der Symbolik zum Staatsaufbau
Echte Solidarität würde bedeuten, von palästinensischen Führungen Verantwortung einzufordern. Stattdessen belohnt Europa allzu häufig eine Politik, die mehr auf Symbolik als auf Staatsaufbau setzt. Seit den Oslo-Abkommen flossen Zehn- bis Zwanzig Milliarden Dollar an Hilfsgeldern in palästinensische Institutionen. Ein nicht unerheblicher Anteil verlor sich in Patronagenetzwerken; Gelder finanzieren Verwaltungsapparate, die oft mehr verwalten als entwickeln.
Gaza wird von einer Organisation regiert, die politische Gewalt einsetzt; im Westjordanland hat die politische Führung Reformen und freie Wahlen immer wieder verschoben. Wer in Europa aber ausschliesslich von Opfer und Aggressor spricht, verweigert die komplexe Realität: Der Appell an Sympathie darf nicht die Verpflichtung ersetzen, effektive Institutionen zu fördern.
Aktivismus als Wohlfühlzone
Unser Gedankenexperiment hat einen weiteren Protagonisten: die lautstarke, transnationale Aktivistin und der performative Demonstrant. Diejenigen, die Slogans skandieren, die sich in europäischen Städten gegen Israel und Zionismus stellen, geniessen Schutz, Resonanz und mediale Aufmerksamkeit.
Im satirischen Szenario dürfen sie selbstverständlich bleiben – aber nicht als blosse Zuschauer: Wer so laut nach einem «Palästinenserstaat» ruft, steht jetzt mitten im Projekt. Wenn diese Bewegungen in das «neu-europäische Palästina» integriert würden, müssten sie dort ihre Forderungen politisch umsetzen und die Folgen tragen – inklusive der Frage, wie sich Protestkultur in staatliches Handeln übersetzt. Reden ist leicht, regieren ist schwer – und genau da beginnt der Realitätsverlust.
Das Gewissen zum Nulltarif
Performative Empathie ist Europas erneuerbare Energiequelle. Sie treibt Proteste, Pressemitteilungen und Parlamentsdebatten an, erzeugt aber keinerlei Strom für die Menschen, die zwischen Mittelmeer und Jordan leben. Parolen wie «From the river to the sea» mögen poetisch klingen, beschreiben in der Konsequenz aber die Auslöschung eines vorhandenen Staates, nicht die konstruktive Schaffung eines neuen.
Würde irgendeine europäische Demokratie eine solche Forderung für die eigene Bevölkerung akzeptieren? Das Schweizer Gedankenexperiment liefert die Antwort.
Was Anerkennung wirklich heissen müsste
Anerkennung sollte bedeuten, die Realität anzuerkennen – zwei Völker mit legitimen Ansprüchen und gegenseitigen Verpflichtungen. Sie sollte den Aufbau von Institutionen fördern, Bildungsprogramme unterstützen, die Koexistenz lehren, und eine klare Forderung nach Transparenz gegenüber NGOs und UN-Strukturen enthalten.
Wer als NGO oder UN-Agentur in Genf Politik macht, sollte sich künftig an denselben Standards messen lassen wie Regierungen: Rechenschaft, Transparenz, Wirkungsmessung. Alles andere ist gut gemeinte Selbsttäuschung.
Wer Frieden will, muss mehr investieren als Empörung. Er muss politisches und moralisches Kapital dort einsetzen, wo Veränderung nötig ist: in der palästinensischen Selbstverwaltung, in regionaler Diplomatie – und in Europas eigener Zivilgesellschaft, die radikale Narrative unkritisch übernimmt. Neutralität darf nicht Gleichgültigkeit bedeuten, und Solidarität nicht Einseitigkeit.
Die fiktive «Bundesverordnung 07-24/25» wird nie im Feuille fédérale erscheinen. Doch sie erfüllt ihren Zweck: Sie hält Europa einen Spiegel vor und zeigt, wie moralische Reinheit nur so lange bequem ist, wie jemand anders den Preis zahlt.
Frieden entsteht nicht durch Parolen. Er entsteht, wenn Empathie auf Verantwortungsbereitschaft trifft – wenn Anerkennung beide Seiten umfasst, statt eine aus dem Bild zu wischen, um das eigene Gewissen zu beruhigen.
Solange das nicht geschieht, bleibt Europas Umgang mit Israel und Palästina ein Theaterstück: Das Theater der moralischen Bequemlichkeit.
Dan Deutsch ist Creative Director und Produzent in Zürich. Er gründete im Oktober 2023 die Nonprofit-Initiative NAIN Switzerland (Never Again Is Now) sowie 2024 Mishelanu, ein DACH-weites Netzwerk, das jüdische Resilienz im Alltag stärkt. Er engagiert sich gegen Antisemitismus im Sinne der IHRA-Definition und für sachliche Aufklärung im öffentlichen Diskurs.
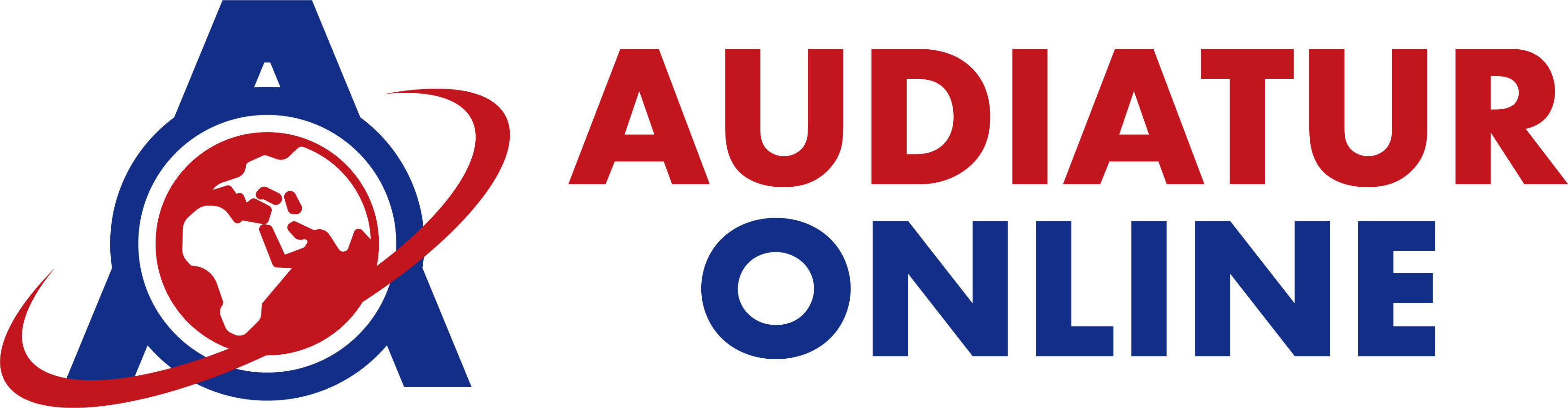





























Es ist erstaunlich, dass Länder, die eine Zwei-Staaten-Lösung verfolgen, diese nie in ihren eigenen Ländern umsetzen erwarten. Auch wenn dieser Prozess leider bereits in Europa begonnen hat, ist es nicht unrealistisch zu glauben, dass Frankreich und das Vereinigte Königreich folgen werden.
Man würde annehmen, dass europäische Länder, einschließlich US-Verbündeter, die einen ‚palästinensischen‘ Staat anerkennen wollen, dies irgendwie ausgleichen würden, indem sie Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkennen und Botschaften dorthin verlegen, wie es die USA getan haben?
Bei über 20 arabischen Staaten, die Israel nicht anerkennen, scheint diese jüngste Entscheidung von Großbritannien und Frankreich eine offenkundige Akzeptanz von Terrorismus zu sein und das nächste 7. Oktober in Europa zu ermöglichen?
Ich hoffe, die Schweiz folgt diesen suizidalen Wahnsinnigen nicht und hält sich raus. Es sollte auch keinen Grund geben, dass Schweizer Steuerzahler genozidale Terrorcamps finanzieren?